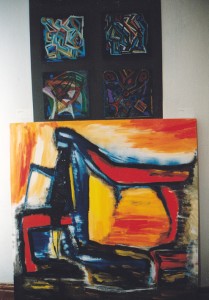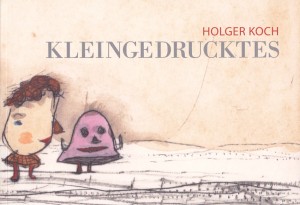Eine knappe Woche nach dem 200. Geburtstag Wagners lässt das Getöse etwas nach, der Nachhall ist aber immer noch heftig. Dabei geht es neben der Frage, ob der Tonsetzer denn wirklich so genial war, wie von seinen Fans behauptet (ich selbst halte die Pixies für viel genialer), vor allem um die (un)menschliche Seite RWs. Und da stoßen Burgunderheere auf Hunnenhorden.
Über seine Musik kann ich nichts sagen. Ich höre allgemein keine Opern, also fehlt mir der Vergleichsmaßstab. Peter Korfmacher, Chef der LVZ-Kulturredaktion ist aber auf diesem Gebiet Kenner. Und seinen Artikel am 22. Mai, dem Geburtstag, fand ich nicht nur wegen der sprachlichen Ausdruckskraft bemerkenswert. Er sagt auch ganz klar, dass Wagner ein Scheusal war: Gewiss: Antisemitismus war salonfähig im werdenden und jungen Reich. Er lag sozusagen in der Luft. Dennoch ist Wagner keineswegs nur mitgeschwommen, sondern hat sich als widerwärtiger Pamphletist an vorderster Front hervorgetan. Dass er dies aus persönlicher Befindlichkeit heraus tat, weil er neidisch war auf Meyerbeer oder Mendelssohn, das macht die Sache nicht besser. Im Gegenteil. Und da Wagner Zeit seines Lebens nicht müde wurde, seine Weltanschauung, sein Denken und sein Werk als Einheit zu verkaufen, ließe man ihn allzu leicht wieder aus der Schlinge, folgte man der Argumentation seiner Verehrer, man müsse die Musik sorgsam trennen von den menschlichen Defiziten ihres Schöpfers. Wenn dies bei einem nicht funktioniert, dann bei Richard Wagner.
Promt gibt es Proteste. In der heutigen LVZ wird einLeserbrief abgedruckt, in dem eine Frau ausdrückt, wie befremdlich sie diese Bemerkungen findet. Sicherlich war es nicht die einzige Zuschrift dieser Art.
Ähnlicher Meinung, aber mit ganz anderer Zielrichtung, ist ein sich Holger nennender Leipziger Blogger. Auf seiner Seite Diesseits von Gut und Böse schrieb er vorige Woche einen Text, in dem er auf das vermeintliche Verschweigen von Wagners Antisemtismus hinweist. Dass dies Satire sein soll, habe ich nicht bemerkt. Da ich mindestens einmal wöchentlich in Seiten von Neuen Rechten, zu denen Holger gehört, hineinsehe, sind mir Behauptungen wie „Niemand außer uns bemerkt Fehlentwicklungen im deutschen Bildungssystem“ nur zu vertraut, um darin irgend welchen Humor zu bemerken. Und wenn man Holgers Text dann wirklich als Satire nimmt, steht eben trocken da: „Dass die Journalisten so intensiv auf Wagners Antisemitismus hinweisen, ist doch bescheuert. Wer mag denn wirklich Juden?“ Das ist der Humor der Rechten.
Auf der anderen Seite äußert sich Volly Tanner in einem Interview: Wagner braucht keine Werbung, der ist ja schon tot und hat nichts mehr von der Aufmerksamkeit, nur die die sich in seinem Schatten verstecken und seinem Gedankenschlecht anhängen, die haben etwas davon. Nun bin ich nicht immer mit Tanner einer Meinung – er hat mich ja auch aus der Liste seiner FB-Freunde geworfen, weil ich ihm in den Sandkasten gepinkelt habe – hier aber muss ihm vollkommen Recht geben. Und auch, wenn er sich über die literarischen Qualitäten von Wagners Librettis äußert. Ich denke genau so, dass in dieser Beziehung Harry Potter viel anspruchsvoller ist. Und den lese ich trotzdem nicht.
Das Denkmal von Balkenhol finde ich gut. Wenn man schon nicht auf eine Weihestätte für den Kleinen verzichten kann, dann sollte sie so aussehen. Dass die DSU, eine Sekte, die ich schon für ausgestorben hielt, dagegen protestierte, zeigt hervorragend, wie gelungen der Entwurf ist.
Zwar laufen noch diverse Ausstellungen zu Wagner weiter, aber der Schlachtenlärm verhallt allmählich. Vielleicht können sich in der kommenden Spielzeit auch die Opernhäuser im deutschsprachigen Raum dazu durchringen, mal keinen Ring, keinen Tannhäuser oder sonst eine germanophile Heldensaga zu inszenieren. Die Ruhe wäre erholsam.