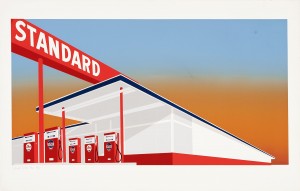Der Untertitel „Wie Ober- und Unterschicht unser Land ruinieren“ von Walter Wüllenwebers Buch „Die Asozialen“ legt eine Ähnlichkeit zu Tilo Sarrazins Kampfschrift „Deutschland schafft sich ab“ nahe.
Eine grundlegende Übereinstimmung findet sich tatsächlich. Auch Wüllenweber geht von der These aus, dass Arbeit und Leistung per se nützlich für das Gemeinwohl seien. Zu Sarrazins zweiter Prämisse, dass nämlich jedem Tüchtigen der Weg nach oben offen stehe und Faule von ober her unweigerlich absinken, teilt er nicht. Im Gegenteil: „Die 60er und 70er mit ihren außergewöhnlichen Möglichkeiten für alle Klassen waren eine historische Ausnahmesituation. Vor allem für die Generation der Babyboomer ist sind diese Zeiten längst vorbei. Doch noch immer prägt die längst vergangene Ausnahmezeit die Vorstellung, die sich viele von den Aufstiegsmöglichkeiten machen. Sie glauben noch an das Märchen von der Chancengleichheit.“
Walter Wüllenweber analysiert zwei gesellschaftliche Gruppierungen, die er nicht nur für asozial, sondern auch als gefährlich für die Gemeinschaft ansieht. Es sind die Superreichen sowie die arbeitsunwillige unterste Schicht. Messbares Kriterium für die Oberschicht, bzw. die High Net Worth Individuals, die HNWIs, ist das frei verfügbare Kapital von einer Million Dollar, also etwa 750 000 Euro. Von dieser Gruppe, die in Deutschland größer ist als anderswo, grenzt er aber noch einmal jenes Promille der Bevölkerung ab, welches annähernd ein Viertel des Vermögens besitzt, womit zunächst auch nur Geld auf überprüfbaren Konten gemeint ist. Und er macht klar: Erarbeitet haben sich diese Leute diese Summen keineswegs. Einkommen sei Reichtum für Anfänger, Fortgeschrittene lassen das Geld selbst arbeiten. Die wohlhabenden Promis, die man in Society-Journalen Champagner schlürfen sieht, gehören in der Regel nicht dazu. Sie haben zumeist noch einen, wenn auch überproportional dotierten, Job. Die echten Reichen, häufig Erben, verstecken sich hinter ungestrichenen Zäunen, sind auch in den Medien nicht sichtbar.
Dieser Gruppierung stellt Wüllenweber diejenigen gegenüber, die man traditionell als Asoziale bezeichnet. Auch hier differenziert er, macht die Zuordnung nicht formal am verfügbaren Geld oder generell am Empfang von Transferleistungen fest, sondern am Verhalten innerhalb der Gesellschaft. Es sind diejenigen, sie sich weder um Arbeit, noch um Bildung oder sonstige Formen der Teilhabe bemühen. Die sozialromantische Vorstellung mancher Linker, dass die Betroffenen dazu gezwungen werden, versteht der Autor zu widerlegen.
Walter Wüllenweber ist langjähriger Journalist beim Stern. Er zieht seine Fakten nicht nur aus Statistiken und offiziellen Untersuchungen, sondern immer wieder auch aus Recherchen an der Basis. Daraus ergibt sich eine plastische Sprache, manchmal etwas zu aufgeladen mit Metaphern. Die Besichtigungen vor Ort gelingen ihm besser bei der Unterschicht. Die „ganz oben“ igeln sich ein. Er muss eingestehen, nicht dicht rangekommen zu sein. Das hat er mit den Finanzbehörden gemein.
Es mag seltsam erscheinen, die zwei gegensätzlichsten Gruppierungen in einen Topf zu werfen. Doch es finden sich tatsächlich Gemeinsamkeiten. Das ist zunächst – für Wüllenweber Hauptmerkmal – die Nichterbringung von verwertbaren Leistungen. Weiterhin die Abkoppelung von der Mehrheit, also kaum politische oder gemeinnützige Aktivitäten, sowie die freiwillige Ghettobildung. Und – das macht den zweiten Teil des Buches aus – beide bringen „Hilfsindustrien“ hervor. Das hochspekulative Investmentbanking auf der einen Seite steht seit dem Crash von 2008 im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, ohne dass sich etwas an den Strukturen ändern würde. Die Industrie der Helfer auf der anderen Seite, die von den Beschäftigtenzahlen zur größten Branche in Deutschland geworden ist, ist selten Gegenstand von Untersuchungen. Ein System aufzuzeigen, das nicht an einer Beseitigung von Armut interessiert sein kann, weil es davon profitiert, ist ein Verdienst des Buches.
Ein nicht zu unterschätzendes Unterscheidungsmerkmal von „Die Asozialen“ zu „Deutschland schafft sich ab“ ist, dass Wüllenweber klar hervorhebt: Die asoziale Unterschicht hat trotz eines hohen Anteils von Migranten nicht ursächlich mit der ethnischen Herkunft zu tun.
Allerdings teilt er mit Sarrazin die These, dass Leistung eingefordert werden muss. Was im ganzen Text spürbar wird, bringt er im Schlussteil unmissverständlich zum Ausdruck: „Wirtschaftswachstum ist positiv.“ Eine Kapitalismuskritik kann man ihm also nicht unterstellen. Auch 40 Jahre nach dem ersten Bericht des Club of Rome ist für den eigentlich kritisch denkenden und differenzierenden Autor eine Infragestellung des Wachstumsfetischismus kein Thema, nicht einmal am Rande. So lässt sich auch verstehen, weshalb er alle, die nicht zu den von ihm untersuchten Gruppierungen gehören, als eine große Mittelschicht bezeichnet, die das Auskommen beider asozialen Ränder ermöglicht. Zu dieser Mitte gehören Aldi-Kassiererinnen gleichermaßen wie angestellte Manager von Großkonzernen.
Es spricht für Walter Wüllenwebers Redlichkeit, im Nachwort selbst zu betonen, dass er Lösungen anzubieten nicht als seine Aufgabe ansieht. Filtert man Ansätze von Vorschlägen aus dem Buch heraus, klingt das auch wenig praktikabel. Im Grunde vertritt er den Standpunkt, dass wir zurück müssen zum traditionellen Sozialstaat wie auch zu einer Besteuerung von Spekulationsgewinnen, die es tatsächlich schon einmal gab. Das hört sich an nach Sozialdemokratie früherer Jahrzehnte. Ob dies für die drastisch veränderten globalen Konditionen ein Rezept ist, erscheint fraglich.